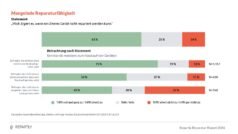Seit den ersten Berichten über die Verschmutzung der Meere und Küsten mit Mikroplastik intensivierte sich auch die weltweite Forschung dazu. Inzwischen ist klar, dass Mikroplastik auch in unsren Flüssen und Seen sowie in Getränken und Lebensmitteln allgegenwärtig ist.

Mikroplastik – Was ist das eigentlich genau?
Nach gegenwärtiger Definition sind das Kunststoffpartikel kleiner als fünf Millimeter. Die untere Grenze liegt bei einem Mikrometer, also einem Tausendstel Millimeter. Partikel in der Größe von einem Mikrometer bis zu 100 Nanometern werden als Sub-Mikroplastik bezeichnet, Partikel kleiner als 100 Nanometer als Nanoplastik. Studien zeigen, dass die meisten Plastikpartikel im unteren Mikrometerbereich zu finden sind.
Die Partikel können in der Umwelt durch die Fragmentierung größerer Plastikteile entstehen, sie bilden sich im Straßenverkehr durch Reifenabrieb und in Form feinster Fasern beim Waschen von Kleidung mit Kunstfaseranteil. Außerdem wird Mikroplastik in Körperpflegeprodukten eingesetzt, beispielsweise in Zahnpasta.
Warum müssen wir uns Sorgen machen um Mikroplastik?
Eigentlich ist noch gar nicht klar, wie gefährlich Mikroplastik wirklich ist. Sicher ist, dass solche Partikel von Lebewesen aufgenommen werden, natürlich auch von Menschen. Das allein ist aber nicht hinreichend, um toxische Effekte zu erwarten. Es wird allerdings auch diskutiert, dass kleinere Partikel in bestimmte Gewebe von aquatischen Organismen gelangen können.
Weltweit werden pro Jahr inzwischen rund 400 Millionen Tonnen Kunststoff produziert. Ein erheblicher Teil davon landet in der Umwelt und braucht dort unter Umständen mehrere Hundert Jahre bis er abgebaut ist.
In den nächsten Jahrzehnten müssen wir daher mit einer massiven Zunahme von Mikroplastik in der Umwelt rechnen. Gleichzeitig wissen wir, dass auch inerte und an sich ungefährliche Stoffe ab einem Schwellenwert zu unvorhersehbaren Effekten führen können.
Warum weiß man so wenig über die Folgen?
Bei den ersten Messungen hat man teilweise einfach optisch sortiert. Leider ist diese Methodik sehr fehleranfällig. Ein Sandkorn und ein Plastikpartikel von weniger als einem Millimeter Durchmesser sehen sehr ähnlich aus.
Im Rahmen eines durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekts „MiWa“ haben wir zum Beispiel in einer Probe aus der Elbe 3.000 Partikel chemisch analysiert. Nur etwa eines von Tausend Partikeln war tatsächlich Kunststoff. Neben Kalk und anderen Mineralien gibt es ja auch noch organische Stoffe. Deswegen ist die Entwicklung zuverlässiger und standardisierter Methoden extrem wichtig. Sonst sind die Messwerte nicht vergleichbar.
Und: Wir reden hier über sehr geringe Konzentrationen, das heißt auch über sehr geringe Effekte. Bei einigen Versuchen mit hohen Konzentrationen von Mikroplastik hat man negative Effekte beobachtet, andere haben keine Effekte gesehen.
Hier steht die Forschung noch ziemlich am Anfang. Was nicht heißt, dass wir noch warten sollten. Angesichts der langsamen Abbauraten müssen wir uns dringend überlegen, wie wir den Eintrag von Kunststoffen in die Umwelt reduzieren können.
Mit welchen Methoden kommt man dem Mikroplastik auf die Spur?
Je nach Fragestellung wird die Analytik von Mikroplastik zurzeit mit verschiedenen Methoden durchgeführt: Thermoanalytische Methoden, gekoppelt mit Gaschromatographie und Massenspektrometrie liefern Werte für die Masse unterschiedlicher Plastiksorten und deren Additive in einer Probe – geben jedoch keine Aussagen über die Partikelgröße.
Spektroskopische Methoden liefern Informationen über die chemische Identität sowie Größe und Form von Mikroplastikpartikeln. Die Infrarot-Mikrospektroskopie ist in der Lage, Partikel bis ungefähr 20 Mikrometer automatisch zu analysieren.
Bei uns am Institut wenden wir vor allem Raman-mikroskopische Analysen an. Das ist eine zerstörungsfreie spektroskopische Methode, die Fingerabdruck-Spektren liefert und eine verlässliche Identifizierung der Partikel ermöglicht. Damit können wir sehr gut zwischen synthetischen Polymeren und natürlichen Substanzen wie Zellulose oder Quarz unterscheiden.
Außerdem können wir die Plastiksorte feststellen. Eine Kopplung des Raman-Spektrometers mit einem optischen Mikroskop erlaubt es uns, Partikel bis hinunter zu weniger als einem Mikrometer zu analysieren. Somit können wir eine Aussage über die Anzahl, die Größenverteilung und die Polymersorten von Mikroplastikpartikeln in der Probe treffen.
Wir konnten bereits zeigen, dass sich Mikroplastikpartikel im Darm von Wasserflöhen anreichern können. Außerdem haben wir in einem vom Bayerischen Umweltministerium geförderten Projekt festgestellt, dass Muscheln die besonders kleinen Mikroplastikpartikel aufnehmen und im Körper anreichern.
Wie geht es nun weiter?
Für eine repräsentative und statistisch belastbare Aussage zur Mikroplastik-Verunreinigung müssen sehr viele Partikel pro Probe untersucht werden. Deswegen arbeiten wir in einem von der Bayerischen Forschungsstiftung (BFS) geförderten Projekt „MiPAq“ an der Automatisierung der Raman-basierten Analyse.
Da Plastikpartikel mit abnehmender Größe ein höheres ökotoxikologisches Potenzial besitzen, sind die Methoden zur Analyse solch kleiner Partikel von besonderem Interesse. Daher entwickelt unser Institut in dem vom BMBF geförderten Vorhaben „SubµTrack“ zusammen mit vier weiteren Lehrstühlen der TUM die Analyse sehr kleiner Partikel weiter.
Liegen erst einmal genügend vergleichbare Ergebnisse für die Belastung von Umwelt- und Lebensmittel-Proben mit Mikro- und Nanoplastik vor, kann man mögliche negative Effekte für die Umwelt und uns Menschen untersuchen. Dafür sind ökotoxikologische Studien mit Mikroplastik unter Berücksichtigung von relevanten Plastiksorten, Größen, Formen und vor allem Konzentrationen notwendig.
Würden Sie nun die Herstellung von Plastik verbieten?
Nein, ich würde in keinem Fall auf Kunststoff komplett verzichten, weil es ein vielseitig einsetzbares Material ist und viele Vorteile bringt. Aber man muss Kunststoff richtig nutzen. Vor allem müssen wir den Eintrag von Kunststoff in die Umwelt verringern. Und hier ist nicht nur die Industrie gefragt, sondern jeder kann selbst etwas dafür tun.